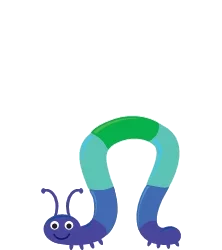Leistungsbereiche
Unsere Leistungsbereiche beinhalten umfassende Hilfeleistungen für Kinder, deren Entwicklung unter erschwerten Bedingungen verläuft
- Diagnostik
- Frühförderung
- Heilpädagogische Spieltherapie (Heilpädagogisch-therapeutisches Spielen) und Filialtherapie
- Sensorische Integration
- Wahrnehmungsförderung
- Basale Stimulation
- Psychomotorik, Motopädie
- Entspannungstechniken
- Heilpädagogische Sprachförderung
Unser Leistungsangebot ist konzipiert für
- Kinder, von Geburt bis zur Einschulung (Heilpädagogische Frühförderung)
- Kinder nach der Einschulung (Kinder- und Jugendhilfe § 27 Flexible Hilfen, Eingliederungshilfe für seelische beeinträchtige Menschen § 35a SGB 8)
Es besteht die Möglichkeit für ein Offenes Beratungsangebot. Es kann von Ihnen niedrigschwellig in Anspruch genommen werden und richtet sich an Eltern mit Kindern von Geburt bis zur Einschulung.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht nicht das „Fehlende“ in der Persönlichkeitsentwicklung, eine Entwicklungsstörung oder eine Behinderung des Kindes, sondern das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und seinen Stärken, eingebunden im familiären und sozialen System.
Frühförderung
Frühe Hilfen sind wirksame Hilfen!
Frühförderung ist die Begleitung und Entwicklungsförderung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren.
Sie baut auf den Stärken des Kindes auf, fördert die kindlichen Kompetenzen und aktiviert Ressourcen.
Kinder haben ein Recht auf gleichberechtigte Beteiligung, Bildung und besondere Förderung und Fürsorge bei Behinderungen.
Die Entwicklung eines Kindes verläuft individuell. Jedes Kind verspürt den Drang nach Selbstaktualisierung und Weiterentwicklung in sich. Manchmal benötigt es hierbei jedoch zusätzliche Unterstützung.
Kinder profitieren von der heilpädagogischen Frühförderung, wenn sie folgendes beobachten:
- das Kind kann sich nicht lange mit einer Sache beschäftigen, es ist auffallend unruhig
- das Kind hat keinen altersgerechten Wortschatz und kann wenig Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen
- es liegt eine Risikobelastung vor, z.B. psychische Erkrankung in der Familie, Frühgeburt
- das Kind hat Defizite in seiner Bewegungsentwicklung, es bewegt sich unsicher und fällt häufig
- eine fehlende Schulreife wurde festgestellt, es zeigen sich kognitive Einschränkungen
- das Kind zeigt wenig Interesse an seiner Umwelt
- das Kind hat eine Sinnesbeeinträchtigung
- andere Formen einer Behinderung
Der/die HeilpädagogIn in der Frühförderung handelt professionell, individuell und prozessorientiert.
Wir legen Wert auf eine tragfähige Beziehungsgestaltung zum Kind und auf ein individuelles, alters- und kindgerechtes Förderangebot. Wir haben das Ziel, das Kind und seine Familie im Alltag zu unterstützen, sowie die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Ziele in der Frühförderung:
- allgemeine Entwicklungsverzögerungen ausgleichen
- Kommunikation und Interaktion stärken, Sprachentwicklung anbahnen und unterstützen
- Förderung der Motorik (Grob- und Feinmotorik, Graphomotorik)
- Förderung der kognitiven Fähigkeiten (Denkentwicklung)
- Förderung der emotionalen Entwicklung und des Sozialverhaltens
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kita, TherapeutInnen, ÄrztInenn
Antragsstellung:
- Damit Ihr Kind Frühförderung erhalten kann, ist ein Arztbesuch erforderlich. Eventuell hat Ihr KinderarztIn Sie schon bei einer U-Untersuchung darauf aufmerksam gemacht und Frühförderung empfohlen. Der/die ArztIn stellt eine entsprechende Ärztliche Bescheinigung aus.
- Dann benötigen Sie eine pädagogische Diagnostik, die durch den/die HeilpädagogIn der Frühförderstelle/Heilpädagogische Praxis durchgeführt wird. Im folgenden Förderplan werden die individuellen Förderziele des Kindes zusammen mit den Eltern verfasst.
- Abschließend kann der Antrag auf Frühförderung gestellt werden. Dabei sind wir gerne behilflich! Bei Zusage des Kostenträgers kann die Frühförderung beginnen.
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ist für die Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB 9) – Frühförderung zuständig und übernimmt die Kosten.
Das Kind wird Schritt für Schritt auf seinem individuellen Entwicklungsweg begleitet, gefördert und therapiert.
- Wir unterstützen durch Begleitung und Beratung der Familie
- Wir orientieren uns an den Bedarfen der Familie und führen die Frühförderung im Kindergarten, im häuslichen Umfeld oder in den Räumlichkeiten der Praxis durch.
Diagnostik
Für die Antragsstellung Eingliederungshilfe/Frühförderung benötigt der Kostenträger eine pädagogische Diagnostik. Es wird in der Regel das standarisierte Verfahren des Entwicklungstest ET 6-6-R (F. Petermann& T. Macha) durchgeführt.
Die Ergebnisse bilden die Grundlage für den Förderplan. Ziel ist nicht die Festschreibung einer Problematik und Entwicklungsnorm, sondern ein besseres personales und situatives Verstehen von Erleben und Verhalten des Kindes.
Die Ermittlung des Entwicklungsstandes setzt sich zusammen aus einer umfassenden Anamneseerhebung, einer eingehenden medizinischen Untersuchung und den Einsatz nominierter Testverfahren. Die Diagnostik gestaltet sich, sofern sich daraus eine Maßnahme der Frühförderung ergibt, als Eingangs- Verlaufs- und Abschlussdiagnostik, und ist somit prozessorientiert ausgerichtet.
Heilpädagogische Spieltherapie (Heilpädagogisch-therapeutisches
Spielen)
Die Heilpädagogische Spieltherapie orientiert sich am Klientzentrierten Ansatz von Rogers. Die Haltung des/der TherapeutIn ist empathisch einfühlend, kongruent und akzeptierend.
Das heilpädagogisch-therapeutische Spielen bezeichnet den dynamischen Prozess zwischen Kind und SpieltherapeutIn, in dem das Kind in seinem Tempo vergangene und gegenwärtige, bewusste und unbewusste Inhalte erkundet, die sein Leben derzeit beeinflussen.
Spielen hat eine zentrale Bedeutung für die ganze kindliche Entwicklung und steht im Mittelpunkt der kindlichen Erlebens- und Erfahrenswelt. Sie bietet dem Kind Hilfe, sich selbst zu erforschen, da es sich noch nicht gezielt gedanklich und emotional mit sich selbst reflektierend auseinandersetzen kann.
Die symbolische Sprache des Kindes kann offenbaren, was das Kind erlebt hat, wie es auf diese Ereignisse reagiert, welche Gefühle damit einhergehen und wie es sich selbst und seine Bedürfnisse wahrnimmt.
Im therapeutischen Spielen kann es seine Erfahrungen ordnen, sie neu organisieren und damit dem Bewusstsein zugänglich machen.
Gerade Kinder mit emotionalen Problemen und Verhaltensstörungen bevorzugen das therapeutische Spielen und profitieren davon.
„Das Spielen ist die Königsdisziplin des Lernens“
Filialtherapie
Ziel dieser Herangehensweise ist Eltern-Kind-Interaktionsproblemen einer Lösung zuzuführen. Dazu wird ein gemeinsamer Spielkontext mit einem Elternteil konstruiert, in dem die Prinzipien der Klientzentrierten Spieltherapie mit eigenen Möglichkeiten umgesetzt werden. Vater oder Mutter als „Laientherapeut“ werden von mir vorbereitet und unterstützend während des Prozesses begleitet. Erziehungskompetenzen können so gesteigert und familiäre Selbsthilfepotenziale aktiviert werden. Die Eltern erfahren, wie sie mit relativ einfachen Mitteln zur Verbesserung der Familienatmosphäre beitragen können. Das Kind erlebt die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse im Spielen in Gegenwart des elterlichen Spielpartners auszudrücken um somit auf diese Weise Fremd- und Selbstwertschätzung zu erfahren.
Die Eltern werden anschließend supervisorisch im laufenden Prozess begleitet.
Sensorische Integration/Psychomotorik (Motopädie)
Dr. A. Jean Ayres entwickelte die Theorie der Sensorischen Integration, um Zusammenhänge zwischen Verhalten und neuralen Prozessen, bzw. zwischen Verhalten und sensorischer Verarbeitung (Integration) besser erklären zu können.
Definition: Unter sensorischer Integration versteht man jenen neurologischen Prozess, bei dem vom eigenen Körper und der Umwelt ausgehende Sinneseindrücke geordnet werden und der es dem Menschen ermöglicht, seinen Körper innerhalb der Umwelt sinnvoll einzusetzen. Räumliche und zeitliche Aspekte der verschiedenen Sinneseindrücke werden interpretiert, verknüpft und vereint. Sensorische Integration bedeutet Verarbeitung von Informationen.
Das Gehirn muss unter ständig wechselnden Bedingungen sensorische Informationen auswählen, vergleichen und verknüpfen bzw. die Aufnahme verstärken oder verhindern. Mit anderen Worten: Das Gehirn hat die Aufgabe, Informationen zu integrieren.
Der Bereich der Wahrnehmung umfasst das visuelle, auditive, vestibuläre, taktile und das propriozeptive Sinnessystem.
Die Psychomotorik ermöglicht Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen und somit eine Grundlage für eine harmonische Persönlichkeitsentwicklung. Der Fokus liegt nicht auf einer Leistungsorientiertheit, sondern setzt auf spielerische frei und ungezwungene Auseinandersetzung mit der eigenen Ich-/Sach- und Sozialkompetenz.
Das Kind lernt:
- Alle Sinnesbereiche werden aktiviert
- Grob- und Feinmotorik wird geschult
- Raumwahrnehmung
- Sozialerfahrungen und Ansprache der eigenen Persönlichkeit
- Fantasie